Das Verständnisintenive Lernen (ViL) ist ein Lernansatz, bei dem die Verstehensprozesse der Schüler stärker in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns des Lehrers gestellt wird.
Lernen ist ein erfahrungsabhängiger, aktiv-konstruktiver Aufbau von Wissen, Können (Fägigkeiten und Fertigkeiten) und Überzeugungen.Beim verständnisintensiven Lernen ist das Verstehen grundlegend und qualitätsbestimmend für das Lernen. Daran soll der Unterricht ausgerichtet sein. Beim Verstehen als kognitiver Modellierungsprozess wirken Erfahrung, Vorstellung, Begreifen und Metakognition zusammen.
Merkmale der Strukturqualität von Lernen
Erfahrung: eingenes Erleben, Wahrnehmung, , Handeln, praktisches Denken
Vorstellung (Imagination): sinnesnahes, erfahrungsanaloges Denken
Begreifen: logisch-begriffliches Denken, denken in Kategorien und Zusammenhängen
Metakognition: selbstreflexive Begleitung und Optimierung des Lernens, Nachdenken über das Denken
Merkmale der Prozessqualität von Lernen
Kompetenz:: Schüler entwickeln und zeigen Kompetenzen beim Lernen, “Ich kann es.”
Autonomie:: durch Schüler selbstbestimmtes Lernen, “Ich bin es.”
Eingebundenheit: Schüler sind beim Lernen in eine Lerngruppe eingebunden, “Ich gehöre dazu.”
Beim Lernen setzen sich Schüler aktiv und modellierend mit dem Stoff auseinander. Z. B.
- eigene Hypothesen entwickeln
- Experimente planen und durchführen
- nach Zusammenhängen und Gründen forschen
- Widersprüche finden
- alternative Lösungen suchen
- Anwendungsmöglichkeiten finden
- eigenes Erlerntes Anderen darstellen
- Fehler erkennen und analysieren
- selbst Aufgaben konstruieren
- eigene und fremde Leistungen beurteilen
Grundstruktur des verständnisintensiven Unterrichts
Der Lehrer muss durch einen Perspektivwechsel ein Verstehen zweiter Ordnung aufbauen.
Der Perspektivwechsel dient dem Lehrer zu erkennen ob es eine Differenz zwischen seinem Verstehen und dem Verstehen, das die Schüler beim Lernen im Unterricht entwickeln, gibt. Er wird hierdurch in der Lage sein das Lernen der Schüler co-konstruktiv zu begleiten und zu fördern.
- Dazu muss der Lehrer selbst über unterschiedliche fachliche Sichtweisen (Varianten der Modellierung) verfügen, um die Sichtweise eines Schülers (und damit sein Lernen) zu antizipieren.
- Die Lehrer sollen sich über individuelle Zugänge und Modellierungsformen des Stoffes mit den Schülern verständigen.
- Zur Förderung des vertieften Verstehens bei dem Schüler soll der Lehrer in der Lage sein verschiedene methodische Strategien und didaktische Ansätze zu realisieren.
- Die vom Lehrer getroffene Auswahl zu Inhalt und Abfolge von Aufgaben richtet sich nach dem Verstehensprozess der Schüler.
- Dabei soll schöpferisch und selbstreflexiv mit Fehlern und Suchbewegungen kindlicher Lernaktivität umgegangen werden.
- Es erfolgt eine strikte Trennung von Lernsituation und Leistungssituation.
Verständnisintensives Lernen setzt einen am ViL ausgerichteten Unterricht (“verständnisintensiver Unterricht”) und eine auf Verstehen ausgerichtete Diagnostik (Lernförderdiagnostik) voraus.
- Der Lehrer unterstützt den Schüler beim Lernen fachlich und persönlich.
- Der Unterricht ist schüleraktiv und lehrergesteuert gestaltet.
- Dem Schüler muss jederzeit klar sein, welches die nächsten Arbeits- und Lernschritte sind.
- Die Selbststeuerung des Lernens durch den Schüler nimmt im Laufe des Lernprozesses immer mehr zu.
- Organisatorische Maßnahmen und Arbeitsmittel, Methodenwechsel und Medieneinsatz fördern die innere Differenzierung und berücksichtigen individuelle Lernvoraussetzungen und Lerngeschwindigkeiten.
- Der Lehrer nimmt die Lernprozesse zunehmend aus der Schülersicht wahr.
- Überraschende und unübliche Äußerungen werden nicht beiseite geschoben, sondern aufgegriffen.
- Anerkennung und Ermutigung fördern den Lernvorgang. Es werden Demütigung und Abwertung vermieden.
- Offene Fragen und echte Probleme werden aufgeworfen.
- Eigene Auffassungen werden durch Argumentation transparent gemacht.
- Der Lehrer reflektiert selbst eigene Stärken und Schwächen im didaktisch-methodischen Vorgehen und der pädagogischen Betreuung.
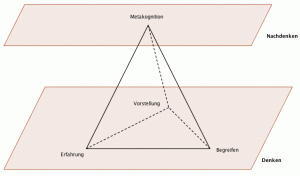
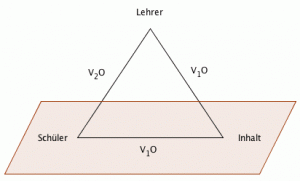
Sorry, the comment form is closed at this time.